


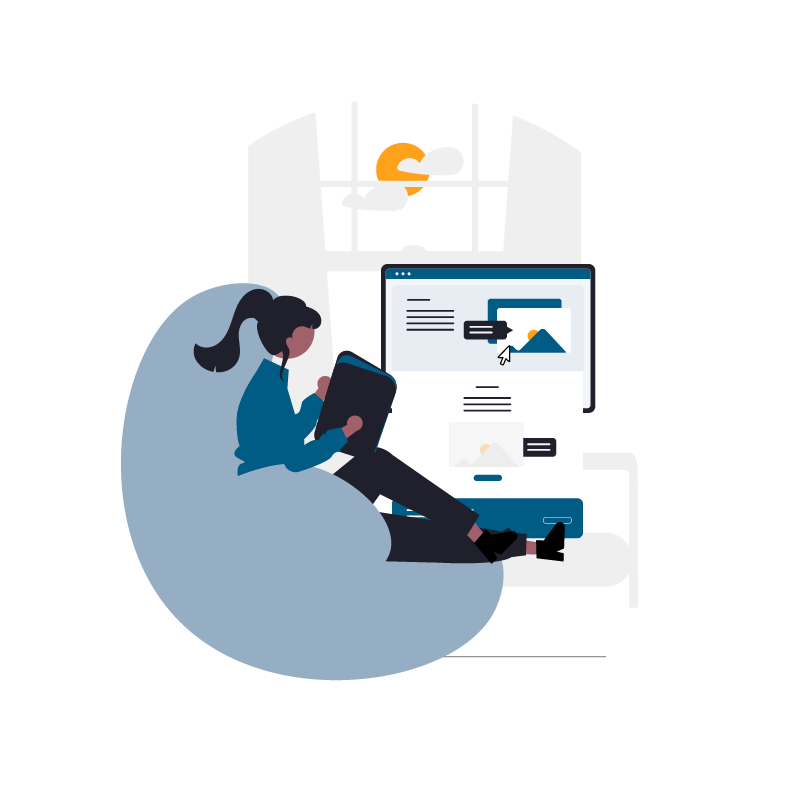

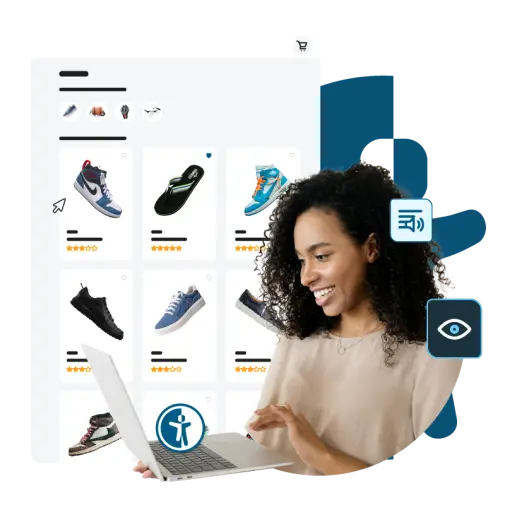
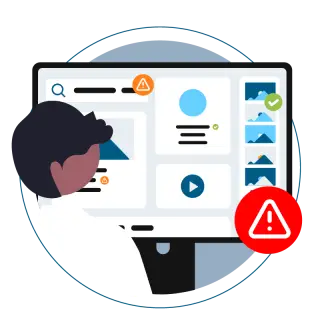
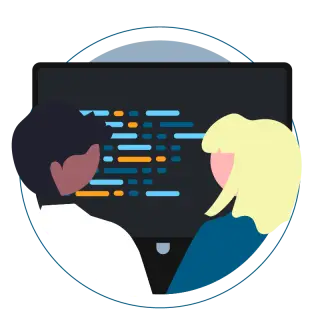
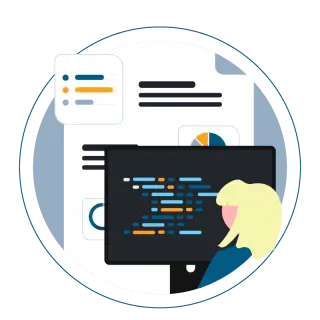

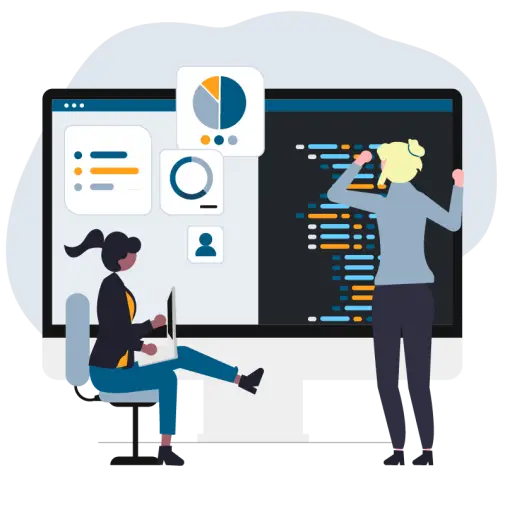
Die Umsetzung von Barrierefreiheit klingt oft kompliziert – muss sie aber nicht sein. Mit der richtigen Kombination aus Analyse, Technik und gezielten Maßnahmen wird Ihre Website schnell zugänglich:
Unser Barrierefreiheitstool ermöglicht eine individuelle Anpassung Ihrer Website auf die spezifischen Bedürfnisse der Besucher. Benutzerfreundlich, ressourcenschonend und DSGVO-konform.
Eine detaillierte Prüfung zeigt, welche Barrieren auf Ihrer Website bestehen. Dabei orientieren wir uns an den WCAG und BITV-Anforderungen.
Durch gezielte Maßnahmen und Beratung stellen Sie sicher, dass Ihre Website den gesetzlichen Anforderungen entspricht und für alle nutzbar ist.
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) ist ein deutsches Gesetz, das seit dem 23. Juli 2021 gilt und seit dem 28. Juni 2025 vollständig verbindlich ist. Es verpflichtet Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen barrierefrei bereitzustellen, damit sie von allen Menschen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, genutzt werden können. Grundlage sind die europäischen Vorgaben aus der Richtlinie (EU) 2019/882. Ziel ist die digitale Teilhabe und ein einheitlicher Standard für Barrierefreiheit
Vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz 2025 sind alle Unternehmen betroffen, die Produkte oder Dienstleistungen für Verbraucher anbieten. Dazu gehören insbesondere Betreiber von Webseiten, Online-Shops, Banking-Portalen, E-Book-Diensten und Apps. Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und bis zu zwei Millionen Euro Jahresumsatz sind teilweise ausgenommen. Öffentliche Einrichtungen wie Behörden oder Kommunen sind über die BITV und das BGG bereits zu barrierefreien digitalen Angeboten verpflichtet.
Wer die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes nicht erfüllt, riskiert rechtliche und wirtschaftliche Folgen. Die Marktüberwachungsbehörden können nicht konforme Angebote vom Markt nehmen, Nachbesserungen verlangen oder Bußgelder verhängen. Neben möglichen Sanktionen drohen auch Reputationsverluste, wenn digitale Angebote Nutzer ausschließen. Unternehmen, die das BFSG umsetzen, sichern sich dagegen rechtlich ab und profitieren von einer inklusiven Nutzererfahrung, die Vertrauen und Reichweite stärkt.
Um BFSG-konform zu sein, müssen Unternehmen ihre digitalen Angebote nach den WCAG 2.1-Richtlinien und der EN 301 549-Norm ausrichten. Der Prozess umfasst drei Schritte: eine Bestandsaufnahme zur Ermittlung von Barrieren, technische und inhaltliche Anpassungen nach den Standards der digitalen Barrierefreiheit sowie ein kontinuierliches Monitoring. Tools wie der danova Assistant unterstützen dabei, Webseiten individuell anpassbar zu machen und die Barrierefreiheit dauerhaft zu sichern.